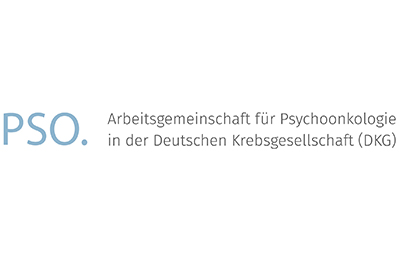„Wer kann besser über die Lebenserfahrung Krebs berichten, als die, die unmittelbar davon betroffen sind?"
Das Schreiben war für Nicole Kultau eine Art Therapie, die ihr nach der Krebsbehandlung half, wieder zurück ins Leben zu finden. Mit ihren Erfahrungen, die sie in einem Online-Blog teilt, möchte sie anderen Betroffenen zur Seite stehen und das Tabuthema Krebs endlich aufbrechen.
Das Schreiben war für Nicole Kultau eine Art Therapie, die ihr nach der Krebsbehandlung half, wieder zurück ins Leben zu finden. Mit ihren Erfahrungen, die sie in einem Online-Blog teilt, möchte sie anderen Betroffenen zur Seite stehen und das Tabuthema Krebs endlich aufbrechen.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) macht sich im Rahmen der NDK für eine Patientenbeteiligung in der Krebsforschung stark. Was bedeutet Partizipation für Sie?
Partizipation in der Onkologie bedeutet für mich Personengruppen wie Patientinnen und Patienten, Patientenvertreterinnen und -vertreter, Patientenorganisationen, Pflegende und betreuende Personen in Entscheidungsfindungen mündig einzubeziehen. Denn wer kann besser über die Lebenserfahrung Krebs, Prioritäten, Bedürfnisse oder über mögliche Zielsetzungen berichten, als die, die unmittelbar von Krebs betroffen sind oder waren? Es ist für mich essentiell wichtig, dass nicht pauschal über andere gesprochen und entschieden wird, sondern auf einer partnerschaftlichen Ebene gemeinsame Ziele erarbeitet und umgesetzt werden.


Was sind aus Ihrer Sicht die drängendsten Themen und Fragen für eine erfolgreiche Patientenbeteiligung in der Forschung?
Gleichberechtigung. Vertrauen. Verständnis. Sowohl aus den Reihen der Forschenden, als auch der Politik und durch einen Abbau von überholten Hierarchien, um miteinander auf Augenhöhe kommunizieren und arbeiten zu können. Aber auch ein gemeinsames Netzwerken unter den Patientenorganisationen sehe ich als äußerst wichtig an, denn in einem gebündelten Wirken könnten diese stärker fokussiert Ziele umsetzen, als wenn sie gegenseitig in Konkurrenz agieren. Aber um all dies und mehr zu erreichen, braucht es für die zuvor genannten Personengruppen, die sich für eine gelungene Partizipation einbringen wollen, benötigte Mittel der Fortbildung und Zugänge in teils noch immer geschlossene elitäre Kreise, um sich für eine diverse Gesellschaft einbringen zu können.
Ein kleines Beispiel zur Verdeutlichung: Ich bin eine alleinstehende und berufstätige Mutter eines Sohnes mit einer Mehrfachbehinderung, die sich für an Krebs erkrankte Menschen und Inklusion einsetzt. Hinter meinem Wirken steht ein großes persönliches Engagement. Aber mir sind Grenzen gesetzt, zeitlich und finanziell. Mit diesem Problem der ewigen Zerrissenheit zwischen Beruf, Familie, angeschlagener Gesundheit und unserem Engagement stehe ich nicht allein.
In allen Bereichen, die nach der Krebsdiagnose relevant werden, erhalten Betroffene hilfreiche Tipps von Ihnen. Die oder der „informierte Patient“ ist Ihnen ein wichtiges Anliegen. Woher haben Sie zum Zeitpunkt Ihrer eigenen Diagnose all diese Hinweise erhalten?
Viele der Informationen trug ich auf den unterschiedlichsten Wegen selbst zusammen – und verstand dabei auch längst nicht immer alle. Ganz gleich ob dies medizinische oder sozialrechtliche Fragen betraf. Zu Anfang meiner Diagnose erlebte ich Ärztinnen und Ärzte, die mir als Patientin den Eindruck vermittelten, dass ich zu wissbegierig sei. Da ich mich mit dieser Haltung jedoch nicht verstanden fühlte, wechselte ich kurzfristig mein Ärzteteam. Im Rückblick betrachtet hat mir diese Entscheidung vermutlich sogar mein Leben gerettet. Damals wie heute mache ich mir bei wichtigen Entscheidungen bewusst: "Die Verantwortung für mein Leben und die Konsequenz aus getroffenen Entscheidungen, trage in erster Linie ich. Wissen rettet Leben und ermöglicht Handlungsspielraum."
Das ist bis heute einer meiner Beweggründe, dass ich mich für an Krebs erkrankte Menschen und ihre Angehörigen einsetze. Den Kummer über die Diagnose kann ich niemandem nehmen. Aber ich kann dazu beitragen, dass fundierte Informationen verständlich und nahbar vermittelt werden.
Was hat Sie bewegt, offen mit Ihrer Diagnose umzugehen und darüber zu bloggen? Erlebten Sie Krebs als Tabuthema und ist es das heute noch?
Als meine Behandlungsblöcke abgeschlossen waren, verspürte ich ein großes Bedürfnis, über meine Erfahrungen zu kommunizieren. Ein wichtiges Ventil wurde dabei das öffentliche Schreiben, eine vielleicht etwas eigenwillige Art der Therapie. Dabei durfte ich die bereichernde Erfahrung machen, dass ich vielen erkrankten Frauen und ihren Angehörigen mit meinen Texten aus der Seele sprach und Worte fand, die sie für ihr Erlebtes oft selbst nicht fanden.
Krebs ist bis heute in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Nicht immer erfahren Erkrankte innerhalb ihrer Familie oder ihrem Freundeskreis die Unterstützung, die sie benötigen. Was sich aber in den letzten Jahren zunehmend verändert hat, ist, dass an Krebs erkrankte Menschen oder ihre Angehörigen ihre Geschichte innerhalb der sozialen Medien mit Betroffenen und Interessierten teilen. Nicht selten entstehen auf diesem Weg enge Freundschaften unter Krebserkrankten oder es bilden sich starke Gemeinschaften, die sich gegenseitig unterstützen. Auch durch ihren offenen Umgang setzt ein langsames Umdenken in der Gesellschaft ein. Denn WIR treten mutig aus dem Tabu heraus und erzählen in berührender Weise aus unserem Leben mit und nach Krebs. Zudem wurden in den letzten Jahren innovative Patientenorganisationen und Selbsthilfe-Projekte gegründet, die alle dazu beitragen, für das Thema Krebs zu sensibilisieren.
Ihre eigene Krebserkrankung liegt 12 Jahre zurück. Seither ist in Forschung und Versorgung viel passiert. Haben Krebspatientinnen und -patienten Ihrem Eindruck nachheute andere Fragen als damals?
Die Diagnose Krebs zu erleben, ist für nahezu alle Menschen und deren Umfeld eine zutiefst traumatische Lebenserfahrung. Meiner Überzeugung nach haben sich die grundsätzlichen Fragen gegenüber damals nicht wesentlich verändert. Betroffene beschäftigen in erster Linie existenzielle Fragen: Wie lautet meine Prognose? Muss ich jetzt sterben oder habe ich eine reelle Chance, die Erkrankung zu überleben? Was wird aus mir und meiner Familie? Welche Behandlungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung und wie werde ich mit den Nebenwirkungen zurechtkommen?
Wo finde ich weiterführende Informationen oder eine für mich geeignete Studie – diese und ähnliche Fragen folgen meist erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sich der erste Schock gelegt hat. Viele Patientinnen und Patienten sind aus den unterschiedlichsten Gründen nicht in der Lage, wichtige Fragen zur Erkrankung oder ihrer Behandlung zu stellen. Einen Überlebensvorteil hat, wer jemanden an seiner Seite weiß, der all diese relevanten Fragen stellvertretend dem Behandlerteam stellen kann.