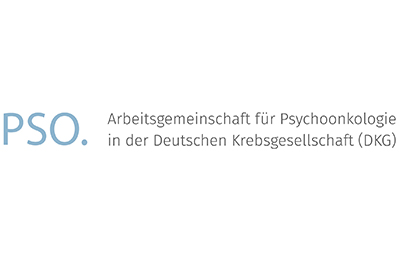Plasma gegen Krebs
Kaltes Plasma bremst das Wachstum von Hauttumoren – das haben nun erste Versuche gezeigt. Sander Bekeschus, Forschungsgruppenleiter am Greifswalder ZIK „plasmatis“, will bald weitere positive Ergebnisse präsentieren.
Seit gut zwei Jahren untersucht der Immunologe Sander Bekeschus in seiner Nachwuchsgruppe „Plasma-Redox-Effekte“ mit einem internationalen Team die Wirkung von kaltem Plasma auf Tumorzellen. Im Fokus stehen Tumoren im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich und das Melanom. Der schwarze Hautkrebs gehört zu den häufigsten Krebsarten. Physiker, Biologen, Chemiker und Mediziner wollen mit Hilfe der Plasmamedizin Krebszellen bekämpfen und damit ein schmerzfreies und gut verträgliches Therapieverfahren entwickeln, das andere, bereits etablierte Methoden der Krebsbekämpfung wirkungsvoll ergänzen kann. Gleichzeitig wollen die Wissenschaftler herausfinden, wie das körpereigene Immunsystem der Erkrankten aktiviert werden kann.


Direkte Plasmabehandlung beim Melanom
Dazu hat die Nachwuchsgruppe zusammen mit der Pharmakologie der Universitätsmedizin Greifswald Versuche an Mäusen durchgeführt. Dabei wurden die Vorgaben der Ethikkommission strikt eingehalten. „Wir konnten nachweisen, dass durch die Plasmabehandlung das Tumorwachstum zurückging“, fasst Bekeschus zusammen. Dabei erwiesen sich unterschiedliche physikalische Plasmaquellen auch als unterschiedlich effektiv. Der globale Ansatz der Plasmatherapie soll nun in weiteren Schritten für die jeweiligen Tumore aufgegliedert werden. Denn die Zusammensetzung des Plasmas, die Plasmaquelle und die Dauer der Behandlung entscheiden über die jeweilige Wirkung.
Die Zwischenergebnisse des Zentrums für Innovationskompetenz (ZIK) plasmatis haben zu einem weiteren Projekt mit der Universitätsmedizin Rostock geführt. Das Vorhaben „ONKOTHER-H“ will das Verfahren optimieren, ein weiteres Anwendungsfeld erschließen und wird im Rahmen des Exzellenzforschungsprogramms Mecklenburg-Vorpommerns gefördert.
Impfung mit toten Tumorzellen
Positive Effekte konnte die Nachwuchsgruppe von Sander Bekeschus auch in einem weiteren Tiermodell beobachten: Die Forscher konnten mit durch kaltes Plasma getöteten Tumorzellen eine Immunantwort induzieren. „Wenn die getöteten Tumorzellen eine Immunantwort ausgelöst haben, dann wachsen die lebenden Tumorzellen nicht an“, erklärt Bekeschus. Die Forscher fanden heraus, dass eine Impfung mit durch Plasma abgetöteten Tumorzellen einen partiellen Schutz bewirkt.


Herzstück des Labors im ZIK plasmatis ist der „High Content Imager“, ein automatisiertes ultraschnelles Mikroskop, „das uns hier in der Region auszeichnet“, wie Bekeschus sagt. Die meisten Fragestellungen auf zellulärer Ebene können damit bearbeitet werden. „Wir machen Bilder von den Zellen, zählen sie mithilfe der Software und schauen uns bestimmte Färbungen mit Antikörpern sowie weitere Parameter an.“ Am Ende entstehe ein komplettes Bild des Gewebeschnitts. „Das Gerät ist in der Lage, die Bedingungen für eine Lebendzelle von 37 Grad Celsius stabil zu halten“, schwärmt Bekeschus. „So können wir Zellen in ihrer zeitlichen Entwicklung beobachten.“
Die letzte Hürde
Internationale Würdigung erfuhren die Fortschritte der Plasmamedizin in Greifswald durch den Plasma Medicine Award 2018. Geehrt wurden die Forschungsarbeiten zur Behandlung von Tumoren im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich an der Universitätsmedizin Greifswald in Zusammenarbeit mit plasmatis.
Parallel zu den Forschungen der Plasmawirkung auf Tumorzellen will plasmatis eine Plasmaquelle für den onkologischen Bereich entwickeln. Auf dem Gebiet bietet das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie Greifswald optimale Bedingungen. Hier haben Physiker, Mediziner, Biologen und Chemiker bereits einige Plasmaquellen – wie den kINPen® MED – entwickelt. Zur Heilung von schweren und chronischen Wunden wird der Wundheilungsstift zunehmend in Praxen und Kliniken angewandt. „Die Plasmamedizinbehandlung zur Wundheilung soll jetzt in den Krankenkassenkatalog aufgenommen werden“, erzählt Bekeschus. „Wenn das erreicht ist, wird auch die letzte Hürde fallen und Ärzte werden sich mehr und mehr der Therapie öffnen.“